Victor Pordes: Das Lichtspiel. Wesen – Dramaturgie – Regie (1919)
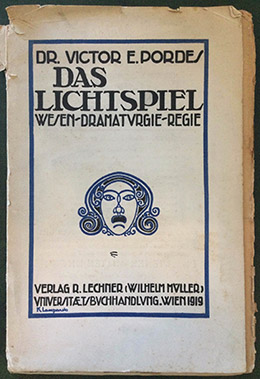 |
| Quelle: Jeanpaul Goergen |
| Buchcover. Titelblattzeichnung: Karl Lamparski |
In dem auf Mai 1919 datierten Vorwort verkündet Victor Pordes stolz, sein Buch "Das Lichtspiel" unternehme zum ersten Mal den Versuch, "das Wesen und den künstlerisch-technischen Aufbau des Lichtspieldramas grundlegend dazustellen"; es handele sich um die "erste Monografie einer neuen Kunstgattung" (S. 3). Nach einem einleitenden Kapitel fragt er nach dem Wesen des Lichtspieldramas, um sich dann mit der Dramaturgie des Lichtspiels zu beschäftigen. In dem größten Kapitel geht er schließlich auf die Regie des Lichtspiels ein, bevor er Schlussfolgerungen formuliert.
Das Kino als Kunstform bezeichnet Pordes als "Lichtspieldrama". Zwar gebe es erst wenige künstlerische Schöpfungen, die Möglichkeit einer Lichtspielkunst sei aber "praktisch eigentlich nicht mehr streitig" (S. 6). Für ihn stellt die Kinematographie "ein neues Prinzip" dar und das "Lichtspieldrama" eine "neue Kunstgattung" (S. 157). Der dokumentarische Film und der Animationsfilm spielen bei ihm keine Rolle.
Im Folgenden kritisiert er einige zwischen 1912 und 1914 erschienene Veröffentlichungen, die er allesamt als veraltet bzw. zu eng gefasst einschätzt. Da der Band kein Literaturverzeichnis enthält, wird dieses unten nachgereicht. Die Vermutung drängt sich auf, dass der Text zu "Das Lichtspiel" bereits 1914 abgeschlossen war. 1916 publizierte Pordes in "Der Kinematograph" unter dem Titel "Theorien über das Kinodrama" eine bearbeitete Fassung seiner Einleitung, ohne aber auf neuere Literatur einzugehen.
Das Kino, so Pordes Ausgangspunkt, sei längst aus seiner ersten Phase heraus, als es "noch grotesk, sprunghaft und überhetzt" war (S. 9). Es sei an der Zeit, das Kino als "eine Kunstart von eigenem Stil, mit in seiner Wesenheit begründeten Gesetzen, Wirkungen und Mitteln" anzusehen (S. 14). In den letzten Veröffentlichungen konstatiert er einen Umschwung "hin zu einer zeitgemäßen, ästhetischen Wertung des Kinos".
Im zweiten Kapitel (S. 16-34) erkundet Pordes das ästhetische Wesen des Lichtspieldramas, das er in der Bewegung als dem technischen Prinzip der Kinematographie begründet sieht. Diese reduziert er auf handelnde Personen, die sich "in einer motivierten, psychologisch richtigen und der dichterischen Endabsicht entsprechenden Weise" bewegen. Daher sei die Natur des künstlerischen Lichtspiels von vornherein gegeben; sie sei "immanent dramatisch". (S. 16) Anschließend wägt er Vor- und Nachteile des Bühnen- und Filmdramas gegeneinander ab. Er erwähnt den Abbildcharakter des Films, vor allem seine Stummheit, die aber durch die Größe des projizierten Bildes, durch Zwischentitel und vor allem seine Möglichkeit, jedes nur erdenkliche Milieu darstellen zu können, aufgewogen werde. Film sei "in erster Linie das Drama der Situation" (S. 19). Der Schauspieler im Stummfilm müsse durch seine "äußere Charakteristik und Kleidung, in Haltung, Mimik und Gestik" wirken; die fehlende Sprache fördere sogar sein Auftreten (S. 20). Wie viele Zeitgenossen sieht auch Pordes im stummen Film ein "Verständigungsmittel der Nationen" (S. 22).
Das Lichtspiel – so seine These – sei eine "durch ein neues technisches Prinzip geschaffene, in ihren weiteren Möglichkeiten noch nicht abgeschlossene neue Form des Dramas" (S. 23). Technische Verbesserungen würden dessen Möglichkeiten stets erweitern. Es sei aber falsch, diese neue Form am Bühnendrama zu messen – schließlich sei dieses selbst aus der Anpassung an die Begrenzungen des Bühnenraums entstanden. Zwei Gegensätze hielten sich im Lichtspiel die Waage: Einerseits die unendliche Erweiterung und Wandlungsfähigkeit der Schauplätze, andererseits die durch die Stummheit bedingte "Vereinfachung des gedanklichen Inhalts" (S. 31).
Dem Wortdrama des Theaters falle es erheblich leichter, das Seelenleben darzustellen als dem stummen Film, der seinerseits besser leicht nachvollziehbare Handlungen wiedergeben könne: "Leidenschaften und Begierden, nicht Anschauungen und Theoreme, sieht man in Tat sich umsetzen, sich begegnen und bekämpfen, und erlebt so vorerst die äußere Fülle des Lebens, das packende Fluten seiner Geschehnisse, die weit von allen Fesseln des Theaters in ihrem ganzen Reichtum uns erschlossen erscheinen" (S. 32). Das Lichtspieldrama müsse dieses Leben in eine künstlerische Form bringen, die auf "seinem Wesen, seiner Eigenart und seinen Grenzen" beruhe (S. 33). Wie dies geschehen soll, erläutert Pordes im nächsten Kapitel über die "Dramaturgie des Lichtspiels" (S. 35-68).
In längeren Ausführungen zum Wesen des Dramas im Allgemeinen thematisiert er die Rolle des Helden, der dramatischen Spannung sowie der zwingenden inneren Logik und Konsequenz der Handlung. Letztere vermisst er in den meisten Filmen: "Was da an Unnatur, an Mangel von Logik und Psychologie, an Aneinanderreihung kitschiger und unwahrscheinlicher Episoden bloß um der Sensation willen, ohne Ahnung von Komposition und Aufbau, geleistet wird, muss auf einen Menschen von Geschmack abstoßend wirken" (S. 42).
Die Dramaturgie des Lichtspiels müsse die technische Eigenart des Mediums berücksichtigen, insbesondere seine Stummheit. Pordes diskutiert daher hier die Verwendung von Zwischentiteln und von Briefen. Im Gegensatz zum Theater müsse sich eine Filmhandlung chronologisch abspielen, um vom Publikum verstanden zu werden. Dem Film weist er die Darstellung des Äußerlichen des Dramas zu; er sei nicht in der Lage, "rein innerliche Konflikte, Zwiespalt und Tragik, die sich in der Seele selbst abspielen", wiederzugeben. Die Hauptschwierigkeit des Films sei nämlich die Frage, wie man "innere Vorgänge: Leidenschaften, Gefühle, Vorstellungsinhalte am besten und verständlichsten zum Ausdruck bringt" (S. 49f). Die Mimik des Filmschauspielers reiche dazu nicht aus, sie lasse viel zu vage Deutungen zu.
Es folgen Überlegungen zum Einsatz von Visionen im Film, um etwa Erinnerungen aufzurufen, sowie zur "Dramaturgie der Gegenstände", die – filmisch herausgehoben – die Handlung verdeutlichen können. Für einen Augenblick werde ein bestimmter Gegenstand "gleichsam dramatisch beseelt, stumm und doch vielsagend" (S. 52). Aus der Stummheit des Films ergebe sich die große Bedeutung der Handlung: "Alles umrahmt sie, dient nur ihr" (S. 60). Nur wenn sie einen künstlerischen Wert habe, könne der Film kulturelle Bedeutung erlangen.
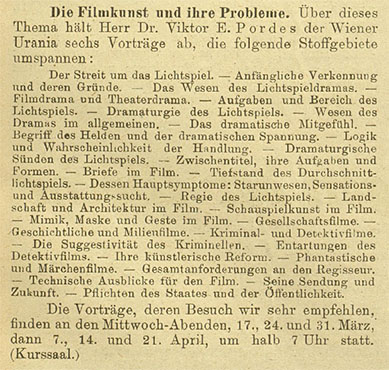 |
| Quelle: Neue Kino-Rundschau, Wien, Nr. 159, 20.3.1920, S. 5 |
| Ankündigung einer Vortragsreihe von Victor Pordes |
Nach Überlegungen zum Filmstar, dem Ausstattungswesen und der Rolle des Dramaturgen beschäftigt sich Pordes im allgemeinen Teil des vierten Kapitels (S. 69-103) ausführlich mit der Regie des Lichtspiels. Unter Regie versteht er die "Einrichtung des Szenenbildes und zugleich die Unterweisung und Leitung des Spiels in allen [...] Einzelszenen" (S. 69). Sie sei größtenteils identisch mit der Theaterregie, wobei aber die Sprechregie entfalle. Anschließend stellt er die Mittel vor, die dem Filmregisseur zur Verfügung stehen, immer im Vergleich zur Theaterregie. Der Film könne zum Beispiel auf die freie Landschaft, auf alle Möglichkeiten des "unendlichen Milieus" (S. 71) in der Bewegung zurückgreifen, dürfe diese aber nur als "Hintergrund und Rahmen" (S. 72) verwenden. Freiluftaufnahmen sieht er ebenso wie Innenaufnahmen unter einem architektonischen Gesichtspunkt, sie sollten vorrangig charakteristisch, lebenswahr und logisch sein; das setze Milieukenntnisse voraus. Die Ausstattung habe sich an der Wirklichkeit auszurichten: "Es sollen, sofern es nur möglich, in erster Linie authentische, also dem Leben entnommene Inneneinrichtungen gefilmt werden" (S. 79). Schließlich würden wir im Film stets ein "Wirklichkeitsbilderbuch" (S. 79) suchen. Und so verlangt er eine Abkehr vom theatralischen Schein und fordert: "Der Wahrheit, dem Wirklichen eine Gasse im Film!" (S. 80). Es folgen Überlegungen zur Bedeutung eines künstlerischen Beirats.
Zur zweiten Hauptaufgabe der Filmregie zählt Pordes die Spielleitung. Auch hier betont er, bei Abweichungen im Vergleich zum Theaterspiel handele es sich um "reine Zwecks- und nicht Wesensunterschiede" (S. 84). Zu diesen Abweichungen zähle u.a., dass der Film viel größere Ansprüche an die Mimik des Schauspielers stelle, etwa bei der Großaufnahme eines Gesichts: "Die Filmschauspielkunst ist zugleich eine epochale Wiedergeburt der Mimik und der Geste, der ganzen Körpersprache schlechthin" (S. 87). Daher plädiert Pordes auch für den Einsatz von "wirklichen Typen" (also Laiendarsteller) statt Schauspieler – allerdings nur dort, wo sie keine wichtigen schauspielerischen Leistungen zu erbringen hätten.
In einem gesonderten Abschnitt des vierten Kapitels geht Pordes detaillierter auf Gesellschaftsfilme, historische und Milieufilme, Kriminal- und Detektivfilme sowie den phantastischen Film und Märchenfilme ein, ohne jedoch neue Ideen einzubringen (S. 103-148). Auch hier geht es ihm um die Mission des Films, auf die Kinogänger im "Theatrum pauperum" (S. 129) erhebend und läuternd einzuwirken.
In abschließenden Bemerkungen schlägt er u.a. vor, den Filmvorspann so knapp wie möglich zu halten und sich auf eine kurze Titel- und Aktangabe zu beschränken; alles andere, auch die Angabe des Regisseurs, des Autors, evtl. des Operateurs, das Personen- und Schauspielerverzeichnis solle ins gedruckte Programm ausgelagert werden. Es ist hier das erste Mal, dass Pordes den Kameramann erwähnt; seine Arbeit und die der anderen Gewerke verweist er in das "Gebiet der kinematographischen Technik", über das er sich aber nicht weiter auslässt.
Nur kurz erwähnt Pordes als letzte Aufgabe des Regisseurs die "Reihenfolge zu bestimmen, in welcher aus einzelnen Szenen und Zwischentiteln der Film zusammenzusetzen ist" (also die Montage) und zu entscheiden, ob Szenen zu kürzen oder aber neu aufzunehmen sind" (S. 103). Nur zweimal führt Pordes auch Filmtitel an (S. 67). Als Beispiele verfehlter Romanverfilmung nennt er "Atlantis" (DK 1913, R: August Blom) nach dem gleichnamigen Roman von Gerhart Hauptmann und "Der Tunnel" (D 1915, R: William Wauer) nach einem Roman von Bernhard Kellermann.
In seinen Schlussbetrachtungen (S. 149-158) wagt Pordes einen Ausblick auf den Farbenfilm, den stereoskopischen und den sprechenden Film, der, so die Befürchtung, seinen "weltumspannenden Zug" (S. 152) in Frage stellen würde. Ideen der Kinoreformbewegung aufgreifend, wünscht er sich von Staat und Gemeinden eine stärkere Förderung der Lichtspielkunst, "um unmittelbar zur Seele des Volkes" (S. 154) zu sprechen. Auch Presse und Kritik sollten sich stärker mit dem neuen Kulturfaktor Film auseinandersetzen.
Die zeitgenössischen Besprechungen beschränkten sich – wie damals üblich – auf kurze wohlwollende Hinweise. Der an Theatermasken erinnernde Buchschmuck stammt von dem österreichisch-polnischen Maler und Grafiker Karl Lamparski (1878-1949). Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie einige Inserate aus der österreichischen Filmwirtschafft beschließen den Band.
Die Filmwissenschaft hat "Das Lichtspiel" bisher nur punktuell rezipiert. So benutzt Siegfried Kracauer (1947/1979, S 65) eine Stelle bei Pordes, wo dieser die detailgenauere und präzisere Ausstattung ausländischer Gesellschaftsfilme im Vergleich zu deutschen Produktionen hervorhebt, um eine generelle "Abneigung gegen den Realismus" in der deutschen Kultur zu belegen. Für Sabine Hake (1993, S. 145) gehört das Buch zur "pretheory" der Filmwissenschaft; sie hebt aber seine wissenschaftliche Herangehensweise – Literaturübersicht und Kritik an den wichtigsten Veröffentlichungen – hervor. Anna Denk (2020, S. 133) stellt das Werk in den Rahmen der österreichischen Filmtheorie und würdigt es als die "erste (bekannte) in Wien publizierte Filmmonografie". Sie sah Pordes noch stark in Theaterkonventionen verhaftet, da er den Filmschauspieler vor allem in Bezug auf Merkmale definiere, die ihm im Vergleich zum Bühnendarsteller fehlten.
Dr. Viktor (Victor) Emanuel Pordes (22.4.1881, Sadowa Wisznia, Galizien / Sudova Vyshnya, Ukraine) war ein jüdischer Rechtsanwalt, Autor und Publizist. Beim Erscheinen von "Das Lichtspiel" wird er als bekannter Mitarbeiter von deutschen Filmfachzeitschriften wie "Der Film" und "Der Kinematograph" vorgestellt (Der Film, Nr. 14, 5.4.1919, S. 94). Im März/April 1920 referierte er in der Wiener "Urania" in einer Vortragsreihe über die Filmkunst und ihre Probleme. Bis 1925 schrieb er noch gelegentlich Aufsätze zu Filmfragen etwa in der Wiener Zeitschrift "Komödie. Wochenrevue für Bühne und Film". Durch eine "privilegierte Mischehe" geschützt, überlebte Pordes die nationalsozialistische Judenverfolgung. Er starb 1963 in Wien.
Von Victor Pordes in "Das Lichtspiel" angeführte Literatur
- Herbert Tannenbaum: Kino und Theater. München: Steinebach 1912
- Theodor Heinrich Mayer: Lebende Photographien. In: Österreichische Rundschau, 31. Jg., Nr.1, 1. April 1912, S. 53-61
- Liesegang: Lichtbild- und Kinotechnik. M. Gladbach: Volksvereins-Verlag 1913 (= Lichtbühnen-Bibliothek; 1)
- Hermann Häfker: Kino und Kunst. M. Gladbach: Volksvereins-Verlag 1913 (= Lichtbühnen-Bibliothek; 2)
- Willy Rath: Kino und Bühne. M. Gladbach: Volksvereins-Verlag 1913 (= Lichtbühnen-Bibliothek; 3)
- Georg von Lukacs: Gedanken zu einer Ästhetik des Kinos. In: Frankfurter Zeitung, 10.9.1913
- Moritz Goldstein: Kino-Dramaturgie. In: Die Grenzboten, Nr. 16, 1913, S. 126-131
- Konrad Lange: Die "Kunst" des Lichtspieltheaters. In: Die Grenzboten, Nr. 24, 1913, S. 507-518
- Ulrich Rauscher: Die Kinoballade. In: Der Kunstwart und Kulturwart, 1. Aprilheft 1913, S. 1-6
- Kurt Pinthus: Das Kinostück. Ernste Einleitung für Vor- und Nachdenkliche. In: Ders. (Hg.): Das Kinobuch. Leipzig: Kurt Wolf Verlag 1914, S. 1-12
- Emilie Altenloh: Zur Soziologie des Kino. Jena: Diederichs 1914
- Dr. Wilhelm Stekel: Theater und Kino. In: Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Nr. 16, 20.4.1914
Literatur über Victor Pordes
- Dr. Victor E. Pordes: Theorien über das Kinodrama. In: Der Kinematograph, Nr. 511, 11.10.1916
- Siegfried Kracauer: From Caligari to Hitler. A psychological History of the German Film. Princeton 1947 [Dt. Frankfurt am Main, 1979]
- Victor Pordes. In: Werner Schuder (Hg.): Kürschners Deutscher Literatur-Kalender. 54. Jg., Berlin 1963
- Sabine Hake: The Cinema's Third Machine. Writing on Film in Germany 1907-1933. Lincoln, London 1993
- Dr. Viktor Emanuel Pordes. In: Barbara Sauer, Ilse Reiter-Zatloukal: Advokaten 1938. Das Schicksal der in den Jahren 1938 bis 1945 verfolgten österreichischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wien 2010, S. 272
- Anna Denk: Schauspielen im Stummfilm. Bielefeld 2020
(Jeanpaul Goergen, Januar 2025)
Dr. Victor E. Pordes: Das Lichtspiel. Wesen – Dramaturgie – Regie. Wien: Verlag R. Lechner (Wilhelm Müller), Universitätsbuchhandlung 1919, 161 Seiten. Titelblattzeichnung und Buchschmuck nach Entwürfen von Karl Lamparski
Traub/Lavies: 678
dnb: https://d-nb.info/575419512