Franz Paul Liesegang: Handbuch der praktischen Kinematographie (1919, 6. Auflage)
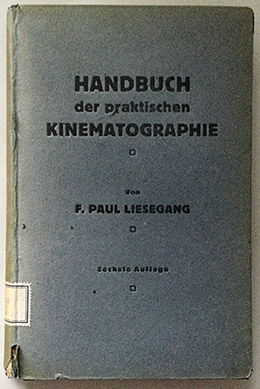 |
| Quelle: Jeanpaul Goergen |
| Buchcover |
Das 1919 erschienene "Handbuch der praktischen Kinematographie" des Physikers und Kinotechnikers F. Paul Liesegang ist bereits die sechste Auflage seines erstmalig 1908 erschienenen Standardwerks der Film- und Kinotechnik. Bis 1928 erreicht es in unterschiedlichen Ausführungen acht Auflagen, die alle in dem Verlag Ed. Liesegang in Düsseldorf erschienen.
Die sechste, umgearbeitete Ausgabe des "Handbuch der praktischen Kinematographie" zählt 353 Seiten; die fünfte Auflage von 1918 hatte 590 Seiten, allerdings in einem sehr großzügigen Layout. Im Gegensatz zum Glanzpapier dieser Ausgabe ist die Nachkriegsauflage auf ärmlichem gelblich-braunen Papier gedruckt, worunter die Qualität der Abbildungen leidet. Der Satz ist nun enger, aber noch gut lesbar. Dass das Werk so rasch eine neue Auflage erlebte, erklärt sich daraus, dass es während des Kriegs ein Jahr lang vergriffen war, wie die Neue Kino-Rundschau (Nr. 1238, 16.8.1919, S. 12) berichtete: "Es wird wohl wenige Bücher technischen Inhaltes geben, die einen solchen Erfolg aufzuweisen haben, wie Liesegangs Handbuch."
Mit dem leicht verständlich verfassten Handbuch unternimmt Paul Liesegang nichts weniger als eine Gesamtdarstellung des Filmwesens von ihrer technischen Seite her. Die verschiedenen Auflagen erlauben es uns, die Fortschritte der Kino- und Filmtechnik in zahlreichen Bereichen nachzuvollziehen. Aus heutiger Sicht sind die zum Teil sehr detaillierten Ausführungen wohl nur noch für Technikhistoriker bedeutsam.
Obwohl die zeitliche Differenz zwischen der fünften und sechsten Auflage gering ist, gibt es eine Reihe von erwähnenswerten Bearbeitungen und Umformulierungen. Die im Vorwort versprochene "gänzliche Umarbeitung" der sechsten Auflage ist allerdings übertrieben. Nur die letzten Kapitel über Sonderformen der Kinematographie – u.a. über stereoskopische Kinematographie, Naturfarben-, Röntgen- und Funken-Kinematographen – wurden stark gekürzt und sprachlich verdichtet; sie seien deutlich über den Rahmen eines Handbuchs hinausgegangen.
Kürzungen gab es etwa in den Ausführungen über "Das Umrollen des Filmbandes" (S. 179), ein Kapitel über das "Verwenden endloser Filme" (5. Auflage, S. 243-245) fiel ganz weg. Neu hinzugekommen ist ein kleiner Abschnitt über der Anwendung des elektrischen Lichts bei der Filmvorführung. Zwar würden die Glühlampen noch nicht für eine große Projektion ausreichen, wohl aber für den Einsatz in der Familie oder in Schulen. (S. 162f) Neu ist auch ein Hinweis auf Entregnungsverfahren für stark verschrammte ("verregnete") Filme; hier helfe Nitrobenzol, das in den Film eindringt und ihn wieder geschmeidig macht (S. 187).
Informationen über die Zusammenstellung von Kinovorstellungen bringt das Kapitel über "Vorführung und Programm" (S. 212-219). Wichtig sei es, den Zuschauern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Das Publikum solle nicht im Dunkeln sitzen, wenn kein Film vorgeführt wird; sobald der Film zu Ende sei, solle der Saal beleuchtet werden. "Ferner richte man es so ein, dass die Zuschauer niemals die weiße Wand zu sehen bekommen" (S. 212). Wenn Filme gekoppelt werden, so habe der Vorführer stets ein Stück Schwarzfilm dazwischen zu kleben.
Bei der Zusammenstellung des Programms warnt Liesegang – ganz im Sinne der Kinoreformbewegung – vor Filmen, die "verrohend wirken und die Sensationslust der Menge züchten" (S. 213). Der Kinobesitzer soll großen Wert auf die Abfolge der Filme legen; wahllos gezeigt, werde ihre Wirkung zerstört. Harte Gegensätze seien zu vermeiden; das Programm solle "abgestimmt und harmonisch" sein und einer Spannungsdramaturgie folgen: "Es wäre z.B. verfehlt, auf einen 'Film zum Totlachen' eine grausige Tragödie zu bringen". Man dürfe auch nicht zu viel des Guten tun, denn dies würde auf die Dauer ermüdend wirken.
Der Kinobetreiber müsse sich zudem nach dem jeweiligen Publikum richten, das er etwa in einer Industriestadt oder in einer Kleinstadt antreffe. Auch Pausen seien nötig: "In den Kinematographen-Theatern wickelt sich das Programm in der Regel in anderthalb bis zwei Stunden ab, und zwar wird es in mehreren Abteilungen gebracht, zwischen denen Pausen von etwa 10 Minuten liegen" (S. 214). Statt einer schlechten Musikbegleitung empfiehlt Liesegang, die Filme stumm vorzuführen. Die Musik könne aber auch durch Geräuscheffekte ergänzt werden. Die kurz vorgestellte Universal-Geräuschmaschine dürfte aber wohl nur für große Kinos in Frage gekommen sein.
Dieses Kapitel blieb im Vergleich zur Erstausgabe von 1908 weitgehend unverändert. Neu hinzu kam der Hinweis auf thematisch ausgerichtete Kinoprogramme, wie sie die "Düsseldorfer Lichtspiele" mit ihren "Wissenschaftlichen Abenden" zu Themen wie "Land und Leute" und "Marineabend" durchführen. Gestrichen wurde der Hinweis, dass es üblich sei, jedes Bild durch einen Titel anzuzeigen. 1919, als die sechste Ausgabe das Handbuchs erschien, war mit der Etablierung des Langfilms die Programmgestaltung der Kinos im Umbruch begriffen.
In der sechsten Auflage von 1919 geht Liesegang ausführlicher auf die Herstellung von Tonbildern und die Atelierbeleuchtung ein. Im Kapitel über "Tonen und Färben" verzichtete er auf die in der 1918er Ausgabe angeführten "bewährten" Rezepte.
Liesegang kürzte auch das Kapitel über die Anwendungen der Kinematographie (S. 318-320). Vor allem die detaillierten Schilderungen über den Einsatz von Filmen etwa in Schulen, der Werbung und der medizinischen Forschung entfielen, ebenso ein Hinweis auf die Notwendigkeit von Filmarchiven. Stattdessen fügte er ein neues Kapitel über die Entwicklungsgeschichte des Kinematographen ein (S. 320-329). Die Erfindung der Kinematographie könne man mit einem "breiten Strom vergleichen, der sich wohl auf eine Quelle zurückführen lässt, der aber sein mächtiges Anwachsen den zahlreichen Nebenflüssen verdankt" (S. 328).
Im Gegensatz zur fünften Aufgabe 1918 mit 231 Abbildungen kommt die Auflage von 1919 mit nur 158 Abbildungen aus. Das Literaturverzeichnis enthält einige Neuerscheinungen von 1918; das Sachregister ist deutlich erweitert. Die im Anhang dokumentierten gesetzlichen Vorschriften für die Sicherheit in den Berliner Kinos von 1912 wurde durch eine im Mai 1919 erlassene Berliner Polizeiverordnung über die Filmbehälter ergänzt.
Paul Liesegang (1873-1949) trat nach seinem Physik-Studium in Straßburg und dem Tod seines Vaters 1896 in die vom Großvater Eduard in Düsseldorf gegründete "Fabrik für Projektions-Apparate, Kinematographen und Lichtbilder" ein. Neben Weiterentwicklungen von Projektionsgeräten im eigenen Unternehmen entfaltete er eine umfangreiche Publikationstätigkeit; sein "Handbuch der praktischen Kinematographie" von 1908 war das erste in Deutschland erschienene Werk über kinotechnische Fragen. Hinzu kam eine kaum überschaubare Zahl an Fachpublikationen im In- und Ausland zu Fragen der Optik und der Projektionstechnik sowie eine ausgedehnte wissenschaftliche Vortragstätigkeit. Seine Zusammenstellung "Zahlen und Quellen zur Geschichte der Projektionskunst und Kinematographie" von 1926 lieferte eine wertvolle Übersicht über die verzweigte Entwicklung der Projektionskünste. Paul Liesegang erhielt 1936 in Anerkennung seiner Forschungen auf dem Gebiet der Kinotechnik die Oskar-Messter-Medaille.
(Dank an das Filmmuseum Düsseldorf für biografische Hinweise)
(Jeanpaul Goergen, Januar 2025)
Franz Paul Liesegang: Handbuch der praktischen Kinematographie. Die Bauart, Wirkungsweise und Handhabung des Kinematographen, das Aufnahmeverfahren und die Anwendungen des Kinematographen. Düsseldorf: Ed. Liesegang 1919. 6., umgearbeitete Auflage, VIII, 353 Seiten, 158 Abb.
Traub/Lavies: 1063
dnb: https://d-nb.info/gnd/126409927