Arthur Lassally: Bild und Film im Dienste der Technik. Zweiter Teil: Betriebskinematographie (1919)
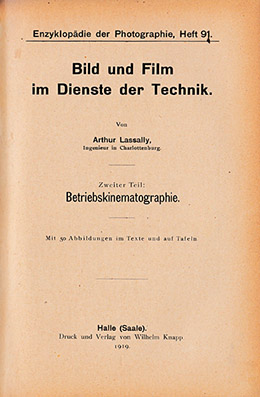 |
| Quelle: Jeanpaul Goergen |
| Buchcover |
1919 brachte der Berliner Ingenieur Arthur Lassally in der "Enzyklopädie der Photographie" des Wilhelm-Knapp-Verlags in Halle das zweiteilige Buch "Bild und Film im Dienste der Technik" heraus. Während sich der erste Teil mit der Betriebsphotographie beschäftigte, war der zweite Teil der Betriebskinematographie gewidmet.
Eingangs beklagt Lassally die "ziemlich magere Literatur" (S. 2) in Bezug auf die technische Kinematografie. Umso höher ist seine Leistung einzuschätzen, handelt es sich doch bei "Betriebskinematographie" um ist die erste umfangreiche Darstellung des weiten Felds des Gebrauchsfilms, insbesondere des Industriefilms. Er stellt zuerst den technischen Film nach seinem Verwendungszweck vor (S. 3-100), erläutert dann die Bedingungen, unter denen technische Filmaufnahmen stattfinden (S. 101-164), um schließlich die verschiedenen Bereiche der Filmherstellung zu beleuchten (S. 165-239). Ein Abbildungsverzeichnis sowie ein umfangreiches Register beschließen den Band.
Im ersten Kapitel detailliert Lassally die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten des Films für technische Zwecke, etwa um Messergebnisse in gleichmäßigen Abständen aufzunehmen. Häufiger waren kinematographische Bewegungsstudien insbesondere zur Optimierung der Arbeitsleistung (Taylorismus). Er stellt die Arbeit von Frank B. Gilbreth vor, der seine Aufnahmen von Arbeitsvorgängen mit einer eingeblendeten Messuhr kombinierte (Messfilmverfahren). Für einige Anwendung könne es hilfreich sein, vom 35mm-Film Einzelbilder oder größere Kontaktbögen herzustellen.
Den technischen Vortragsfilm diskutiert Lassally vor allem unter didaktischen Aspekten und in Bezug auf unterschiedliche Anwendungsgebiete: "Die genaue Anpassung der Bilder und des Vortrages an den Kreis den Beschauer, sowie des Vortrages an die Bilder ist die Grundbedingung für einen wirksamen Vortragsfilm." (S. 35) Ausführlich geht er auf den technischen Lehrfilm ein, dessen Hersteller ebenfalls pädagogische Aspekte berücksichtigen sollten: "Die Regiekunst hat hier große und stark im nationalen Interesse gelegene Aufgaben vor sich; schade nur, dass für solche Kulturaufgaben stets nur magere Geldmittel übrig sind!" (S. 38) Die vor dem Krieg von Pathé frères importierten wissenschaftlichen Filme hätten vor allem dazu gedient, den Kulturwert der Kinematographie zu belegen und weniger im Sinne einer Information über technische Vorgänge gewirkt. Er verweist darauf, dass einige Unternehmen wie die AEG und der Stahlwerksverband bereits in Eigenregie Industriefilme hergestellt hätten, deren Eignung für den Unterricht aber noch zu klären sei. Um technische Unterrichtsfilme herzustellen und zu verleihen, schlägt er eine öffentlich-private Einrichtung vor.
Lassally wendet sich dann dem technischen Werbefilm für den Reisenden sowie dem Film in der allgemeinen Werbetätigkeit zu. Neben seiner Rolle als Angebotsträger (Reklamefilme) sieht er die Bedeutung der Filmpropaganda vor allem auf den Gebieten der Stimmungspflege und der geschäftlichen Repräsentation. Dem Propagandafilm ginge es am wenigsten um unmittelbare Kundenwerbung; er bringe keinen "in Mark und Pfenning kontrollierbaren Nutzen" (S. 54) ein. Auch hier müsse sorgfältig gearbeitet werden, etwa durch die Einbettung des Themas in ein "belehrendes Gewand" (S. 57). Filme, die das Leben der Mitarbeiter eines Unternehmens ohne Schönfärberei darstellten, könnten zudem "gegen die Klassenkampfhetzer" (S. 58) eingesetzt werden. Auch Filme, die für gemeinnützige Zwecke wie etwa für die Kriegsbeschädigtenfürsorge werben, müssten genau und naturwahr hergestellt werden. Als Beispiel für eine schlechte Regie führt er den Film "Wie unsere Kriegsbeschädigten wieder arbeiten lernen" an – gemeint ist wohl "Unsere Kriegsbeschädigten im Beruf und bei Spiel und Sport" von 1916. Für das Kino bestimmte Propagandafilme sollten "auf Allgemeinverständlichkeit, eindrucksvolle Darstellung und Belebung des Interesses" (S. 68) achten und am besten zwischen zwei Filmen gezeigt werden, um die "innere Resistenz des Publikums gegen die Reklame" (S. 70) zu überlisten. Vorführungen vor einem Fachpublikum scheiterten dagegen häufig daran, dass die hierfür benötigte elektrische Leistung fehle.
Lassally bedauert, dass Industriebilder nur noch selten im Beiprogramm der gewerblichen Kinos liefen. Er verweist auf Spielfilme, die zumindest in einem bescheidenen Maße einen technisch-industriellen Hintergrund aufweisen. In "Die Entdeckung Deutschlands" (1917) landeten Marsmenschen in Deutschland und überzeugten sich von der Leitungsfähigkeit der deutschen Industrie. Der Spionagefilm "In den Wolken verfolgt" (1917) spiele zwar in einer Rüstungsfabrik, enthalte aber keinen Werbeeffekt: "Das Publikum verstand den Zusammenhang der Bilder nicht. Die technische Begründung war nicht durchsichtig, einen Propagandagedanken ließ das Ganze nicht erkennen, aber die Bilder waren schön." (S. 82) An "Der Tunnel" (1915) kritisiert er das zu kleingeratene Ingenieurbureau und das wenig elegante Chefbureau. An "König Motor" (1915) beanstandet er eine dilettantisch und ohne technischen Sachverstand inszenierte Reparatur. In "Der Einsiedler von St. Georg" (1916) wird ein Hütteningenieur bei der Nachricht von Schlagwettern in der Grube fast ohnmächtig: Diese Darstellung eines Ingenieurs "spotte seiner ganzen Ausbildung, die darauf hinzielt, ihn in solchen Fällen die Ruhe bewahren zu lassen und andere zu beruhigen." (S. 84) Die Darstellung von Ingenieuren im Spielfilm sei durchweg wirklichkeitsfremd; Lassally empfiehlt den Regisseuren daher, den Rat eines Fachmanns einzuholen. Er rät zu unternehmenseigenen Propagandafilmen, die die Werbebotschaft in eine publikumswirksame Spielhandlung einbetten. Eine Zusammenfassung der Bestrebungen der Kinoreformbewegung beschließen das erste Großkapitel des Buches.
Im zweiten Kapitel stellt Lassally die Bedingungen der technischen Filmaufnahme von den Vorbereitungen über die Aufnahme hin zum Personal in Produktion und Verwaltung vor. Was er für die Herstellung von Industriefilmen ausführt, trifft im Großen und Ganzen auf die Filmproduktion insgesamt zu; seine detailreiche Beschreibung richtet sich vorrangig an jene Leser, die noch nie einen Industriefilm hergestellt haben. Auch für Industriefilme sei ein sorgfältig ausgeführtes Regiebuch" (S. 103) – die Bezeichnung "Drehbuch" war 1919 noch nicht gegeben – notwendig. Bemerkenswert auch, dass er für bestimmte Motive eine bewegliche Kamera vorschlägt, denn Fahrtaufnahmen waren im Spielfilm noch die Ausnahme. Verärgert zeigt er sich über die schlecht erklärten und unzusammenhängenden Bilder des siebenminütigen Films "Bau einer Lokomotive" (1914) , lobt dagegen die filmografisch nicht mehr nachweisbaren Filme "Großmaschinenbau" und "Bau einer Fernleitung über 1000000 Volt".
Das dritte Kapitel beschreibt die gängigsten Kameramodelle, Schwenkköpfe, Kopiermaschinen, Projektoren, die Filmentwicklung, das Färben und Tonen der Filme sowie das Schneiden. Es folgen Hinweise auf Spezialgebiete wie Filmtricks, den plastischen Film, den naturwaren Farbfilm, Stereoskopie, Röntgenkinematographie sowie Zeitlupe. In einem knappen Schlusswort zeigt sich Lassally überzeugt, mit seinen beiden Büchern, die "Daseinsberechtigung der ruhenden und beweglichen technischen Abbildung als ein neues und selbständiges Sonderfach der Wissenschaft" (S. 238) belegt zu haben.
Arthur Lassally (* 19. Februar 1892, Berlin; † 28. September 1963, London) studierte an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg. Er arbeitete als Betriebsingenieur und Gutachter, ehe er 1912 als Mitarbeiter der Gesellschaft für wissenschaftliche Films und Diapositive GmbH in die Filmbranche einstieg. Von 1917 bis 1919 war er in der Filmabteilung der AEG, anschließend bei der Kinoreklame GmbH und der Petra Lloyd AG engagiert. Ab 1921 unterhielt er mit der Film-Ingenieur Lassally GmbH eine gutgehende Industriefilmproduktion. 1939 emigrierte er nach Großbritannien. Sein 1926 geborener Sohn Walter Lassally wurde ein bekannter Kameramann.
(Jeanpaul Goergen, Juli 2023)
Arthur Lassally: Bild und Film im Dienste der Technik. Zweiter Teil: Betriebskinematographie. Halle (Saale): Wilhelm Knapp 1919 (= Enzyklopädie der Photographie; 91), 247 Seiten, mit 50 Abbildungen im Text und auf Tafeln
Traub/Lavies: 1576
dnb: https://d-nb.info/580517012